
Alles in einem anderen Licht: Die letzten drei Wochen, ein Tagebucheintrag, der sich selbst schreiben wollte – und eine trächtige Hündin, die Wasser tritt.
Like the legend of the phoenix,
all ends with beginnings …
»Nicht ganz drei Wochen bis zur Geburt unserer Welpen«, denke ich und kneife geblendet die Augen zusammen. Durch das Geäst der Bäume zieht eine leichte Brise, die Wasseroberfläche des Sees kräuselt sich. Zwei nasse Hunde dösen im Schatten, einer hat es sich zu meinen Füßen gemütlich gemacht. Der Bauch, der mir entgegengestreckt wird, ist ebenso rund wie meine Wange, in der ein leiser Schmerz pulsiert: Drei Weisheitszähne, zwei Zähne in der Front. Der Schmerz ist echt, auch wenn die Schwellung nachlässt. »Geh schwimmen«, sage ich und erinnere mich gehört zu haben, dass Wassertreten gut für Schwangere ist. Und während die eine Hand ganz im Hier und Jetzt, streckt sich die andere nach dem Gestern aus.
Milchzähne kennen keine Gewissensbisse …
Wir waren fünf oder sechs Kinder, vier davon Mädchen und neben mir von Zeit zu Zeit ein weiterer Junge, alle etwa im gleichen Alter, mit den gleichen sonnenverbrannten Gesichtern und den gleichen schorfverkrusteten Knien. Der kreisrunde Wendeplatz am Ende der Sackgasse, gleich vor der wuchernden Mauer, die den Vorgarten unseres Hauses umgab, war unser Spielplatz. Himmel und Hölle und Deutschland erklärt den Krieg (auch ein Kind der friedensbewegten achtziger Jahre dachte sich nichts bei dem Namen), geschossen wurde mit Kreide, weit öfter noch mit Malsteinen, die man zwischen den Neubauten gesammelt hatte, und wer am Ende ohne Land da stand, der weinte bitterlich. Letzteres war meistens ich. Das nicht, weil ich mich am häufigsten der blond, braun oder rotbezopften Übermacht ergeben musste – nein, viel eher, weil ich mich bei allem besonders ungeschickt anstellte und kaum ein Tag verging, an dem nicht Blut, Wasser oder Tränen wegzuwischen waren. Wenn es hieß, mit einem mutigen Satz über die mausgraue Mauer der Nachbarn zu springen, gelang das vier von fünfen. Der fünfte, das also ich, blieb mit dem Zeh in der Sandale an der Kante, und damit auch der kurzgeschnittene Nagel an derselben hängen. Wenn es hieß, den Abhang hinter dem Haus der Nachbarn gegenüber hinunter zu klettern und über den Bach zu springen, brachte ich nicht nur blaue Knie, sondern auch nasse Hosen heim. Hieß es springen, dann fiel ich, ganz klare Sache. Das ich mir dabei weiter nichts dachte, soll nicht stören – Milchzähne kennen keine Gewissensbisse.
Dann bricht der Reifen zum Geschmack von Blut und Asphalt …
Das hölzerne Döschen für die Milchzähne, das mir meine Tante zum Schulanfang in die weiß-blaue Tüte gesteckt hatte, war bereits zu einem guten Stück gefüllt. Zwei waren im Butterbrot stecken geblieben, vier mussten sich dem neugierigen Spiel von Fingern und Zunge ergeben, einige mehr gingen einfach so. Was aus dem Döschen geworden ist, kann ich ebenso wenig beantworten wie die Frage, ob die beiden Zähne, die sich an jenem Nachmittag entscheiden sollten, doch keine bleibenden zu sein, noch im Asphalt stecken oder ob das Schlagloch und der Reifen, die den Grund dafür gaben, mittlerweile geflickt sind. Wahrscheinlich ist nichts von alledem geblieben – nichts, und nur die Erinnerung an ein grünes Fahrrad, das nicht meines war.
Zu fünft oder sechst, so wie immer, und weil das eigene Rad längst langweilig, zum Wettrennen flugs die Räder getauscht. Kaum den Friedhof in Sicht, ich liege weit vorne, stehe vornüber gebeugt in den Pedalen. Dort endet die Straße, ich kann sie schon hören – dann bricht der Reifen zum Geschmack von Blut und Asphalt.
Beide Schneidezähne gehen mir an diesem Nachmittag verloren. Einer von beiden in den Jahren darauf mal um mal. Mal ist es der Kopf eines Klassenkameraden, der Schulhof der Grundschule und taumelndes Grün. Ich schreie erschrocken, doch statt meine zu hören, höre ich die Schreie des anderen. Der schreit, weil er denkt, der Zahn steckt im Kopf, beinahe noch lauter oder ebenso sehr. Beim nächsten Mal ein Ellbogen in der Jungenumkleide, es riecht nach Schweiß und Hormonen in Schuhen. Warum man sich prügelt, weiß ich nicht mehr, nur das ich unterliege und mit ungebremster Wucht, den Kopf wie immer voran, auf das Linoleum fliege. Zuletzt dann Wiedersehensfreude, der Kopf eines Hundes und ein Zahnarzt der meint: »Das muss alles raus«. Das war.
Was war und was wird, was man weiß, was man ahnt, was wir sind …
Der Nachmittag, Malsteine und das grüne Fahrrad, der Schulhof, ein Hund, ein verlorener Zahn, das Kind und der Mensch, der aus diesem geworden – alles verbunden in diesem Moment. Die eine Hand wiegt den Kopf eines Hundes, streichelt und schaudert, die Augen geschlossen. Die andere zögert, hält inne und fragt sich: Säße ich hier, wenn dort, vor zwanzig Jahren, kein Schlagloch gewesen wäre? Würde der Mensch, der statt meiner hier säße, das gleiche sehen und das gleiche fühlen? Den gleichen Schmerz, den Herzschlag des Ungeborenen? Was war und was wird, was man weiß, was man ahnt, was wir sind, gerne wären, was wir vorgeben zu sein? Was wie Wasser verrinnt und in ewigen Kreisen ausstrahlt von diesem einen Moment? Schmatzend schlagen die Wellen ans Ufer. »Nicht ganz drei Wochen bis zur Geburt unserer Welpen«, denke ich und lächle, so gut es nur geht. Zehn Zentimeter mehr um den Bauch, ein Kilogramm schwerer. Die Welt hat Zähne. Wir fallen vielleicht, aber wir beißen zurück.
We’ve come too far to give up who we are …
–
Daft Punk, »Get Lucky«



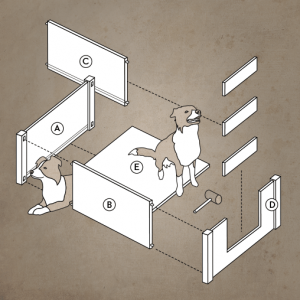



Comments are closed.